Die DDR zwischen Tradition und Moderne
Rezension
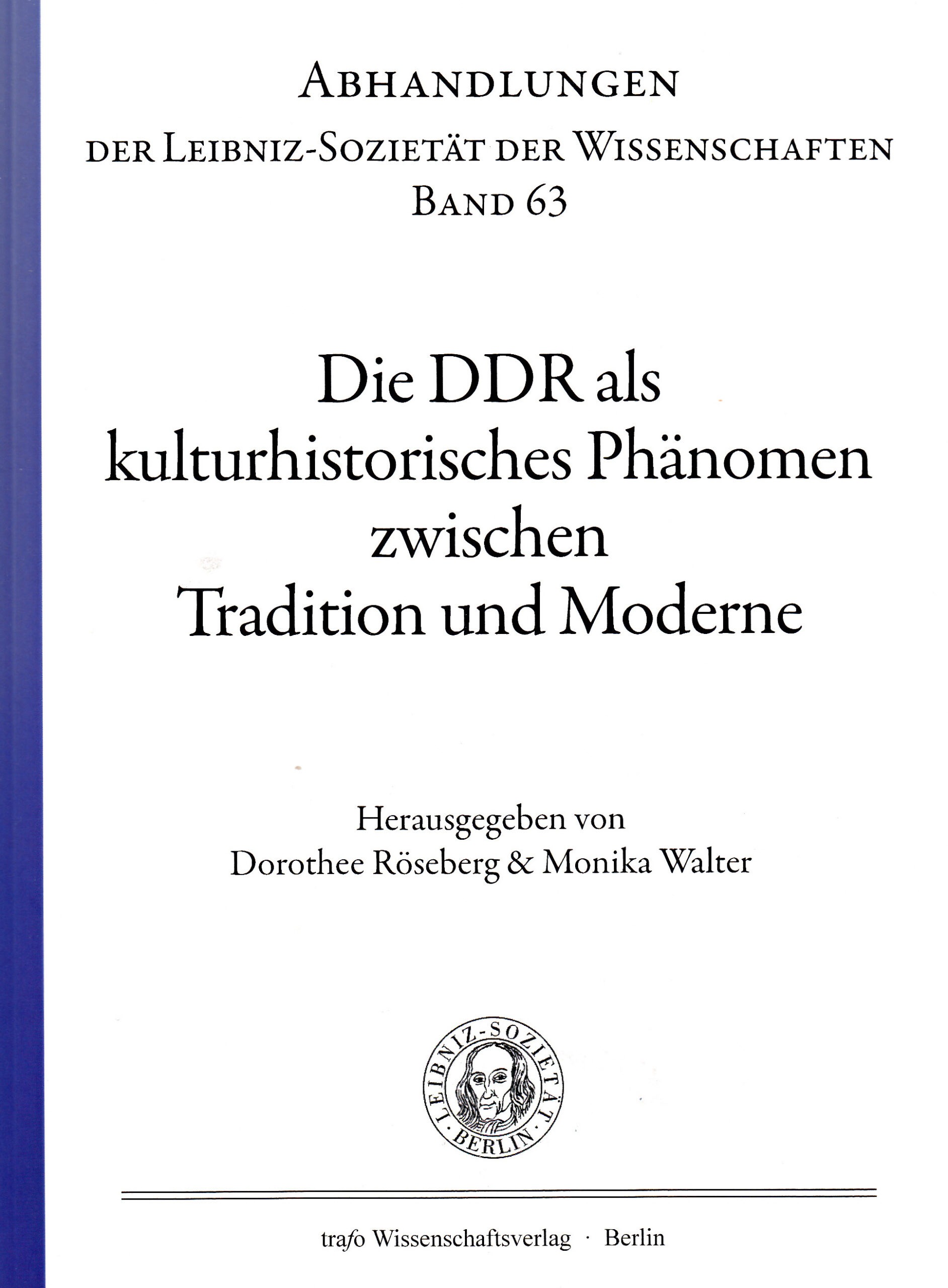 Pünktlich zum 30. Jahrestag des Beitritts der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 erschien der repräsentative Band zur DDR als kulturellem Phänomen. Er bringt an die zwanzig Texte, von denen die meisten etwa ein Jahr zuvor auf einer wissenschaftlichen Tagung der Leibniz-Sozietät gehalten und diskutiert wurden. Der Sammelband geht zwar nicht in der Breite des Kulturverständnisses an das Thema heran, wie es Gerd Dietrich 2018 mit seiner dreibändigen „Kulturgeschichte der DDR“ vorgelegt hatte (der Autor kann aber sein Werk kurz vorstellen, vgl. S. 291–298). Mit seiner gegen einseitige Schwarz-Weiß-Malereien gerichteten Kernaussage, die DDR-Gesellschaft sei wie andere auch „ambivalent“ gewesen, hatte er einige Diktaturforscher zwar etwas aufgeregt, aber inzwischen – es wurde Zeit – schwenkt die historische Forschung auf die methodische Hauptstraße ein, die dialektische Betrachtung geschichtlicher Vorgänge, so auch der vorliegende Sammelband.
Pünktlich zum 30. Jahrestag des Beitritts der DDR zum Geltungsgebiet des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 erschien der repräsentative Band zur DDR als kulturellem Phänomen. Er bringt an die zwanzig Texte, von denen die meisten etwa ein Jahr zuvor auf einer wissenschaftlichen Tagung der Leibniz-Sozietät gehalten und diskutiert wurden. Der Sammelband geht zwar nicht in der Breite des Kulturverständnisses an das Thema heran, wie es Gerd Dietrich 2018 mit seiner dreibändigen „Kulturgeschichte der DDR“ vorgelegt hatte (der Autor kann aber sein Werk kurz vorstellen, vgl. S. 291–298). Mit seiner gegen einseitige Schwarz-Weiß-Malereien gerichteten Kernaussage, die DDR-Gesellschaft sei wie andere auch „ambivalent“ gewesen, hatte er einige Diktaturforscher zwar etwas aufgeregt, aber inzwischen – es wurde Zeit – schwenkt die historische Forschung auf die methodische Hauptstraße ein, die dialektische Betrachtung geschichtlicher Vorgänge, so auch der vorliegende Sammelband.
Wohl um dies zu bekräftigen, ist am Ende des Bandes eine kurze Stellungnahme von Wolfgang Küttler eingerückt worden, der – in einem Podiumsbeitrag – den kulturgeschichtlichen Ansatz hervorhebt, um eine „vergleichende Beurteilung der DDR“ überhaupt erst zu ermöglichen: „Denn dadurch wird diese von der Einhegung in die weitgehend totalitarismustheoretisch orientierten Ansätze der Diktatur- und Ideologiekritik gelöst, ohne deren realen Hintergrund zu ignorieren“ (S. 290).
Küttler problematisiert die ungenaue Verortung der Tagung „zwischen Tradition und Moderne“, wie auch schon die beiden Herausgeberinnen in ihrem Vorwort. Das sei eine „Begrifflichkeit, die in einem bürgerlich-kapitalistischen Kontext entstanden“ sei, aber mit der Orientierung auf „kulturelle Phänomene“ „eine neue Vergleichsperspektive“ eröffne. „Kapitalismus und Kommunismus sollen nicht länger nur unter dem Aspekt ihrer Gegensätzlichkeit betrachtet, sondern können in größere geschichtliche Zusammenhänge eingebettet werden. Politische Formen von Demokratie und Diktatur, die kapitalistischen und sozialistischen Industriezivilisationen und auch die jeweiligen Kulturnationen können und sollen damit in ein neues Verhältnis gesetzt werden.“ (S. 12)
Das wird zum einen etwas inkonsequent praktiziert, denn als ein wesentliches Kriterium von Modernität gelten Fortschritte in der Säkularisierung. Dass hier Ostdeutschland inzwischen als Avantgarde angesehen wird, die den Rückgang von Religiosität in DDR zurückgeht, wird im Sammelband nicht thematisiert. Der spannende Beitrag von Sylvie Le Grand über die Geschichte der Bibeleditionen in der DDR akzentuiert, wohltuend sachlich formuliert, durch den französischen Blick gefärbt, was Theologen motivierte, ihrerseits nicht so scharf gegen „Gottlose“ zu sprechen (S. 185–199).
Da hätte sich der Rezensent bei der Betrachtung der DDR-Pflichtschule (Gert Geißler, S. 73–92) doch wenigstens die Erwähnung der großen Streitthemen der Weimarer Republik und die Positionsbildung dazu in der SBZ/DDR gewünscht: „Einheitsschule“ und „Weltlichkeit des Schulwesens“, was ja auch einschließen könnte, die Wiedereinführung des Religionsunterrichts nach 1990 zu erwähnen.
Nur sehr beschränkt in das Themenraster der Religionsverhältnisse passt der erhellende Text von Frank Thomas Koch über „Antisemitismus und Existenzformen des Jüdischen in der DDR“ (S. 55–72), der sich sowohl auf Individuen und Gruppen wie auf materielle Zeugnisse (Friedhöfe, Synagogen u.a.) bezieht. Der Autor arbeitet DDR-spezifische Konfliktfelder heraus. So sei Antisemitismus durch einen offiziellen Antifaschismus und die Einbindung jüdischer und halbjüdischer Funktionsträger blockiert worden. Doch sei zugleich Antisemitismus gefördert worden, schon durch das unreflektierte Nachwirken der nazistischen Gesellschaft. Doch fehlten nach wie vor empirische Forschungen. Ein Spezialproblem stellen die antizionistischen Vorbehalte der SED gegenüber Israel dar.
Zum anderen liegen gerade in den Hemmnissen, kulturelle Kriterien von Moderne zu entfalten, Gründe für den letztlichen Untergang des gesamten Gesellschaftssystems: die Offenheit der gesellschaftlichen Regelkreise, Funktionalität der sozialen Welten, Anonymität bürokratisierter Institutionen, Heterogenität des Wertehorizonts, geduldete Vielfalt der Überzeugungen, Entwertung des Traditionellen, Herkömmlichen und Ethnischen, Distanz zu allen Bestrebungen von Vereinheitlichung der Lebensweise, sukzessiver Rückgang der Gesinnungskontrolle, zunehmende Kommerzialisierung der Bedürfnisbefriedigung und Politisierung des Ausgleichs von Interessenbeziehungen, um nur einige zu nennen.
Besonders in den Beiträgen von Dietrich Mühlberg, Ursula Schröter und Irene Dölling wird diese Argumentationsbreite erreicht, bei den beiden Letzteren schon der Thematik wegen, die wohl nicht kleinteiliger zu bearbeiten ist.
Mühlberg geht in seinem Beitrag „Zur kulturhistorischen Verortung der DDR. Wie sich in der DDR ein kulturgeschichtliches Selbstverständnis herausbildete“ (S. 21–37) gleich eingangs von der These aus (Hartmut Kaelble zitierend), dass die „Modernisierungstheorie ‘die wichtigste theoretische Anbindung des historischen Vergleichs’ … unterschiedlicher Gesellschaften und Systeme“ darstellt und den „Zugang zum Verständnis ihrer inneren Bewegungen“ bereitstellt. (S. 22) Ohne dieses Gespür für innere Prozesse, so ist festzuhalten, erschließt sich keine Kultur. Der Autor belegt dies an historischem Material durch Beantwortung dreier Fragen: wie in der DDR selbst Kultur historisch gesehen wurde, ob es eigene kulturgeschichtliche Forschung gab und wie mit dieser Kultur aktuell umgegangen wird.
Dazu seien erneut die beiden Herausgeberinnen zitiert: „In der DDR entstand 1963, also vor dem berühmten Birmingham Center, der weltweit erste kulturwissenschaftliche Studiengang. Dietrich Mühlberg, der als Nestor der Kulturwissenschaft in der DDR gelten kann, gibt … Einblicke in historische Voraussetzungen, Zielsetzungen, Profil und praktische Ergebnisse dieser Forschungen.“ (S. 15)
Am Beitrag von Ursula Schröter „Die DDR zwischen Patriarchat und Moderne. Acht Thesen“ (S. 141–152) wird mit der ebenso richtigen wie heutzutage verblüffenden (Stichwort: „Unrechtsstaat“) These argumentiert: Die DDR „war aus einer Menschenrechtsbewegung hervorgegangen und sollte eine Antwort auf die Arbeiterfrage sein“. (S. 139) Dass in der DDR das Patriarchat im Prinzip fortexistierte und die Gleichberechtigung der Frau praktisch nur in Teilen umgesetzt worden ist, wird auf zwei Ursachen zurückgeführt, erstens, dass es sich beim Patriarchat um eine langlebige Gesellschaftsstruktur handelt; zweitens aber durch die Einflüsse des sowjetischen Systems, dass die Arbeiterbewegung faktisch zerbrach und Menschenrechte nicht achtete.
In meinen eigenen Studien zur Biographie von Lotte Rayß (GuLAG-System), aber auch zu Max Hoelz bin ich immer wieder auf das Dogma gestoßen, dass die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln als identisch gesehen wird mit der Einführung des Sozialismus/Kommunismus, als ob das Weitere sich automatisch ergibt. Die Hinweise, auch von Lenin, dass eine „Kulturrevolution“ nötig sei, sind erst in den späteren 1950er Jahren ernsthaft in einem breiteren Verständnis von „Lebensweise“ bedacht worden. Das hat in der DDR eine „Kulturwissenschaft“ befördert, die dann noch ganz andere Fragen stellte. Jedenfalls ist der Wirkung dieses Dogmas genauer nachzugehen.
„Wie modern waren die Geschlechterverhältnisse in der DDR?“ (S. 155–163), fragt Irene Dölling. Sie spitzt diese Frage zu, indem sie umfänglich auf die nach 1990 geführte Debatte eingeht, ob Ostdeutschland in Folge der Geschlechterpolitik der DDR einen „Modernitätsvorsprung“ habe. Dölling konfrontiert die Argumente dafür und dagegen mit sozialen Realitäten und den Widersprüchen darin. Sie kommt zum Ergebnis: „Die Modernität der Geschlechterverhältnisse, die für die sozialistische Variante der ‘organisierten Moderne’ kennzeichnend waren, haben nicht nur zu einem Abflachen von Geschlechterhierarchien und einem Abbau von Geschlechterungleichheiten und einer damit verbundenen Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten vor allem für Frauen geführt. Sie haben sich auch als günstig für eine kapitalistische ‘Landnahme’, also für ihre Nutzung im Verwertungprozeß der postindustriellen Moderne erwiesen“. (S. 161) – Das scheinen nicht zuletzt die ganz aktuellen Berichte – noch nicht Studien – über Ostfrauen in Coronazeiten zu bestätigen.
Eine Rezension kann keine Inhaltsangabe sein und auch nicht alle Beiträge in einem Sammelband umfänglich würdigen, auch wenn sie es verdienen. Es muss aber angeführt werden, was eine interessierte Leserschaft finden kann. Da ist zunächst anzumerken, dass das Buch in zwei thematische Kapitel geteilt ist, erstens in allgemeinere Beiträge, zweitens in speziellere Untersuchungen. Doch sind die Übergänge fließend.
Mario Keßler geht in seinem Beitrag dem Verhältnis zwischen Ost- und Westemigranten in der SED-Gründergeneration nach. Das Thema ist keineswegs keineswegs genügend erforscht. So ist die Frage zu stellen, ob mit den Ausgrenzungen der aus dem Westen Zurückgekommenen (wie der hier gebliebenen wie Heinrich Deiters und der aus den KZ und Zuchthäusern Befreiten) bewusst bestimmte Fragestellungen eliminiert bzw. gar erst zugelassen werden sollten. Klar ist aber, dass alle drei Gruppen weniger vertraut waren mit dem sowjetischen Parteidenken als etwa die Absolventen der NKFD-Umerziehungsschulen, die systematisch in bestimmten Bereichen aufstiegen, wie übrigens auch die vertriebenen „Umsiedler“, die nichts mehr zu verlieren hatten.
Was das meint, zeigt der Text von Hans-Christoph Rauh, der die philosophische Jubiläumskultur als Wandel in den philosophischen Grundthesen vorstellt. Jubiläumskultur in ihren Widersprüchen am Beispiel der Musik Beethovens behandelt Ulrich Busch. Es fehlen in dem Reigen die Luther- und Müntzerehrungen, aber auch, um noch einmal auf das Thema Säkularisierung hinzuweisen, die sich tradierenden Bereiche der Feierkultur, etwa die Jugendweihe, aber auch die Bestattungskultur, beides Phänomene einer ehemals freidenkerischen Gegenkultur, die in der DDR in gewisser Hinsicht „verstaatlicht“ wurde.
Gleichermaßen einvernommen und ihrer christlichen Tradition entkleidet wurden diejenigen Akteure in Partei und Staat, die in den 1920er Jahren dem „Bund religiöser Sozialisten Deutschlands“ angehörten oder nahestanden. Das ist ein Thema für sich. Dorothea Röseberg führt das Wirken eines der bekanntesten Mitglieder in ihrem Beitrag zur Höflichkeitskultur vor – Karl Kleinschmidt: „Keine Angst vor guten Sitten“, 1957 ff. – ohne auf seine Biographie einzugehen. Immerhin war er führendes Mitglied in Thüringen („Ära Kleinschmidt“ 1931–1933) Sein Wirken in der SBZ, dann in der DDR und der Kirche in der DDR bedarf ebenso der Erforschung wie sein Einfluss auf Kongresse über Hutten, Schiller, Luther und Müntzer.
Diane Barbe und Reinhold Viehoff besprechen in ihren Beiträgen das Thema „Berlin“ bzw. Fernsehsendungen „Polizeiruf 110“ und „Tatort“ medienwissenschaftlich und hinsichtlich der ideologischen Ost-West-Auseinandersetzungen.
Adjai Oloukpona wirft aus der Perspektive eines afrikanischen Germanisten einen restrospektiven Blick auf die DDR-Afrikawissenschaften und deren Wirkung auf dem afrikanischen Kontinent. Der französische Historiker Nicolas Offenstadt plädiert für eine symmetrische Anthropologie und Geschichtsschreibung und gegen Unterscheidungen von Verlierern, Besiegten oder Gewinnern der Geschichte. Dieses Herangehen erlaubt ihm – illustriert durch zahlreiche Fotographien – eine „Dialektik von Auslöschen, Widerstand und Neuerfindung der Spuren der DDR“ (S. 273).
In ihrem abschließenden Beitrag fassen die beiden Herausgeberinnen die Ergebnisse der Tagung aus ihrer Sicht zusammen „Anstelle eines Nachwortes. Soziokultureller Wandel in der DDR. Ein Beitrag zur Modernediskussion“ (S. 305–340). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass erst ein Vergleich zwischen kapitalistisch und sozialistisch organisierten Moderne-Varianten das gescheiterte System in einer weltweiten Vergleichsperspektive verorten bzw. in einen zukünftigen globalen Diskurs der Moderne einbringen kann.
Dem ist unbedingt abschließend hinzuzufügen, dass die DDR im osteuropäischen und sowjetischen Sozialismus stets eine Sonderstellung hatte, weil ihre Bevölkerung zu den Kriegsverlierern gehörte und nach wie vor Deutsche waren. Da wäre dann erstens das kulturell Andere zu würdigen, was die DDR immer von den „Östlicheren“ unterschied und sie „westlich“ machte, was ihnen im Westen in der Regel abgesprochen wurde.
Zweitens ist auch das Scheitern des Gesellschaftsexperiments der DDR zu relativieren und klarer zu benennen, was zum Untergang tatsächlich wesentlich beitrug und was allein daraus folgte, dass sich die Sowjetunion geopolitisch übernommen hatte (und die DDR fallen ließ) und die kommunistische Partei seit ihrer Machtübernahme nie in der Lage oder gar Willens war, ökonomische, soziale, politische, kulturelle usw. – jedenfalls moderne – Wertvorstellungen der westlichen Arbeiterbewegung anzuerkennen. Von Chrustschow berichtet sein Sohn Sergeij, dass er sich vor dem Mauerbau ernstlich wunderte, warum die westdeutschen Arbeiter nicht in Massen in die DDR übersiedeln, sondern umgekehrt.
Die DDR als kulturhistorisches Phänomen zwischen Tradition und Moderne. Hrsg. von Dorothee Röseberg / Monika Walter. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag 2020, 343 S. (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Band 63). ISBN 978–3‑86464–214‑2, 39,80 €
Bestellmöglichkeit: www.trafoberlin.de/978–3‑86464–214‑2.html
